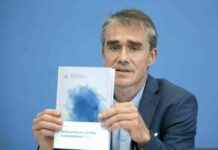Also, nochmal Friedrich Merz (CDU) musste sich mit einem zweiten Ball auseinandersetzen. Sein erster Versuch, Kanzler zu werden, ist gescheitert. Das war das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Kandidat nicht sofort die Mehrheit im Parlament bekommen hat. Es haben nicht viele Stimmen gefehlt, deshalb muss man vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Johann Wadephul (CDU), der nominierte Außenminister, hat gelassen reagiert. Er meinte, wenn Merz erst gewählt sei, würde irgendwann keiner mehr fragen, ob es im ersten oder zweiten Wahlgang passiert ist. Ja, wenn. Wenn sie es nicht geschafft hätten, eine Regierung zu bilden, wäre das eine politische Katastrophe gewesen. Man fragt sich, was den Abgeordneten durch den Kopf gegangen ist, die das riskiert haben.
Die Situation war nicht wirklich neu. Es gab schon öfter Unzufriedenheit unter den Parlamentariern mit Koalitionsverträgen, die ihre Parteiführungen ausgehandelt hatten. Manche haben sich schon immer übergangen oder ausgeschlossen gefühlt. Manche mochten auch schon mal den Kandidaten für die Kanzlerwahl nicht. Dissens ist also nichts Neues. Dass die Norm der Parteidisziplin in der Kanzlerfrage diesmal nicht durchgesetzt wurde, ist jedoch neu. Das wirft die Frage auf, ob es überhaupt der Kopf der Abweichler war, der da etwas durchgebracht hat. Denn egal, ob die Neinstimmen von den Übergangenen und Enttäuschten kamen oder von denen, die die Idee einer Koalition mit der CDU/CSU einfach nicht mögen: In beiden Fällen scheint die Ablehnung von Gefühlen gesteuert zu sein.
Das erklärt auch, warum sich die Abweichler innerhalb der Partei nicht gemeldet haben. Haben sie keinen vertretbaren Text? Mit ihrem Gewissen stellen sie sich immerhin gegen sehr eindeutige Abstimmungen in der Partei. Die Neinstimmen sind also Ausdruck einer unbrauchbaren Subjektivität. Das Motiv des Enttäuschtseins oder das prinzipielle Unbehagen gegen den Koalitionsvertrag kommt hier zum Tragen. Möchte wirklich jemand in der 16-Prozent-Partei der Sozialdemokraten behaupten, es sei besser, nicht zu regieren, als mit der Union zu regieren? Für wen wäre das besser?
Das führt zurück zum Wahlkampf. Das Unbehagen gegen Friedrich Merz wurde durch die Diskussionen um den Entschließungsantrag der Unionsfraktion zur Asylpolitik verstärkt. Merz und seine Anhänger wurden als Teufel dargestellt, die das „Tor zur Hölle“ geöffnet haben. Es schien, als würden sie sich selbst zu Widerstandskämpfern phantasieren. Wer Merz und seine Anhänger noch als „rechts“ bezeichnete, schien zu vergessen, dass der Weg angeblich ins Rechtsextreme führte. Im Wahlkampf wurde so getan, als wären Koalitionen mit anderen ausgeschlossen, als sei das Vertrauen verloren gegangen. Viele zusätzliche Wahlstimmen hat dieses Drama nicht gebracht.
Es wäre also eine böse Farce, wenn diejenigen, die trotz des Wahlkampftheaters ein Abgeordnetenmandat erhalten haben, jetzt auf den letzten Drücker politische Wirkung erzielen wollen. Schon die Idee, im ersten Wahlgang dagegenzustimmen und dann später zuzustimmen, wäre unverantwortlich. Man sollte nach Möglichkeiten suchen, seinen Dissens im parlamentarischen Prozess auszudrücken. Die Abstimmung über den Kanzler ist nicht der richtige Ort für verdruckste Negation.
Die politische Wirkung dieser Handlungen könnte schwerwiegend sein für eine Regierung, die es ohnehin schwer genug haben wird. Wer gegen den Koalitionsvertrag ist, sollte andere Wege finden, um seinen Dissens auszudrücken. Das Gleiche gilt für privates Unbehagen am Regierungspersonal. Die Abstimmung über den Kanzler ist nicht der richtige Ort für verdruckste Negation. Also, mal sehen, was als Nächstes passiert.