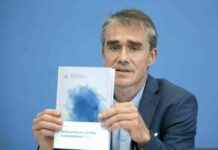Der russische Autor Sergej Lebedew lebt im Exil in Deutschland. Im Gespräch erklärt er, warum die russische Opposition ein schlechtes Bild abgibt.
Sergej Lebedew, der russische Autor, der jetzt in Deutschland chillt, hat mal so richtig ausgeplaudert, warum die russische Opposition einfach nicht so gut rüberkommt.
taz: Herr Lebedew, wenn man die jüngsten Gespräche zwischen den USA und Russland und das Telefonat zwischen Trump und Putin betrachtet: Welchen Plan verfolgt Putin?
Sergej Lebedew: Ehrlich gesagt, ich glaube, Putin will diese „Verhandlungen“ einfach scheitern lassen. Der Typ will die USA und die Ukraine ein bisschen hinhalten, um dann zu sagen: „Sorry, mit Selenskyj wird das nix.“ Putin drückt der Ukraine die ganze Zeit Forderungen auf, die die Ukraine niemals erfüllen kann. Es ist nur ’ne Verzögerungstaktik, Mann.
taz: Wie würden Sie die letzten „Friedens“-Initiativen seitens der USA insgesamt bewerten?
Lebedew: Einfach nur ein Verrat an der Ukraine, Leute. Die USA haben da echt Mist gebaut. In den letzten Wochen haben die Gespräche so ausgesehen, als wären beide Seiten, Russland und die Ukraine, gleichermaßen schuld. Totaler Quatsch, man!
taz: Sie leben im Exil. Wenn wir heute über die russische Opposition im Exil sprechen, von wem reden wir dann? Von vereinzelten kleinen Zirkeln?
Lebedew: Ja, also die russische Exilopposition ist echt nicht so united, um ehrlich zu sein. Der Kreis um Michail Chodorkowski und die Leute vom Nawalny-Team haben schon bisschen Einfluss, aber die können sich nicht mal auf ’ne gemeinsame Agenda einigen. Sieht nicht so rosig aus, Freunde.
taz: Was ist mit jenen Oppositionellen, die im Zuge des Gefangenenaustauschs im Sommer 2024 freigekommen sind?
Lebedew: Also, Deutschland hat da Wadim Krassikow freigelassen, der hat hier in Deutschland ’nen Mord begangen. Keiner von denen, die freigelassen wurden, hat sich je bei der Familie des Opfers entschuldigt. Echt miese Nummer, Leute. Wir brauchen hier dringend ’ne Portion Klarsicht, aber das ist so gar nicht deren Ding.
taz: Stützen all die Oppositionellen wie Wladimir Kara-Mursa, Ilja Jaschin und Julija Nawalnaja imperiale und koloniale russische Narrative?
Lebedew: Naja, ich glaube, die kümmern sich einfach nicht so richtig drum. Die haben keinen Plan, Mann. Die wollen keine vielfältige Gesellschaft aufbauen oder so. Echt schwierig, sowas zu ändern.
taz: Das Nawalny-Team hat sehr viele Anhänger*innen.
Lebedew: Also, in Europa sind die nicht so beliebt, wisst ihr? Schaut mal, wie viele Leute die iranische Opposition auf die Straße bringt. Da kann die russische Opposition echt nicht mithalten, leider.
taz: Worin sehen Sie die Aufgabe der russischen Exilopposition?
Lebedew: Wir sollten echt dafür sorgen, dass Putin und Co. mal zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist echt wichtig, Leute. Wir müssen da was tun, aber es wird nicht leicht, Mann.
taz: Es bräuchte weitreichende Gerichtsverfahren, jahrzehntelange juristische Ausdauer wie nach der NS-Zeit?
Lebedew: Mal sehen, ob das mit ’nem internationalen Tribunal was wird. Wäre echt cool, man.
taz: In einer Welt, in der die Imperialmächte wieder aufleben, scheint Gerechtigkeit für die Ukraine ein hehres und weit entferntes Ziel.
Lebedew: Richtig so, Leute. Einfacher ist es, sich vorzustellen, dass nach dem Krieg ein bisschen Frieden einkehrt. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass russische Kriegsverbrecher einfach so davonkommen. Das geht gar nicht, Mann.
taz: Sie haben kürzlich den Sammelband „Nein! Stimmen aus Russland gegen den Krieg“ veröffentlicht. 25 russische und belarussische Autor:innen sind beteiligt. Wie viele davon leben noch in Russland?
Lebedew: Nur drei, Mann. Der Rest ist abgehauen. Die haben echt viel Scheiße erlebt in diesem autoritären Staat.
taz: Es gibt einige kafkaeske und orwellsche Erzählungen im Band. Kann man über Russland im Inneren nur auf absurde Art und Weise schreiben?
Lebedew: Nicht nur absurde Geschichten, Mann. Auch ein paar realistische sind dabei. Aber die nackte Realität ist echt krass, Leute. Sich dem zu stellen ist echt nicht leicht.
taz: Was wollen Sie mit der Anthologie erreichen?
Lebedew: Also, die soll so ’n Anfang sein, wisst ihr? ‚N bisschen Gemeinschaft und so. Das muss weitergehen, Mann.
taz: Die politische und die kulturelle Sphäre Russlands scheinen völlig getrennt voneinander zu existieren. Kann ein Intellektuellenzirkel überhaupt etwas ausrichten?
Lebedew: Politische Kultur, Mann. Gibt’s in Russland nicht wirklich. Politik und Kultur müssen zusammengehen, Leute. Das ist echt wichtig, Freunde.
taz: Wie sieht Ihre Vision einer politischen Kultur in Russland aus?
Lebedew: Russland muss echt mal dekolonisiert werden, Mann. Viele Minderheiten da, die auch mal gehört werden sollten, Leute.
taz: Stehen Sie in Kontakt mit ukrainischen Intellektuellen?
Lebedew: Klar, Mann.
taz: Wie verläuft dieser Austausch?
Lebedew: Einfach so, auf persönlicher Basis. Ist echt wichtig, Freunde. Irgendwann wird das schon wieder besser, hoffentlich.
Und das war’s auch schon, Leute. Sergej Lebedew hat echt viel zu erzählen, Mann. Hoffentlich ändert sich da mal was in Russland.