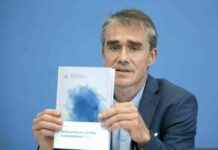Der Demokrat Bill Clinton war der letzte amerikanische Präsident, der Haushaltsüberschüsse produzierte. In den Neunzigerjahren schnellten die Renditen für US-Staatsanleihen so schnell nach oben, dass sich die Regierung zum Sparen gezwungen sah. Clinton reformierte den Sozialstaat und schrumpfte die Bundesverwaltung um 400.000 Beschäftigte. Clintons Berater James Carville, beeindruckt von der Macht der Kapitalmärkte, prägte damals folgende Sätze: „Früher dachte ich, wenn es eine Wiedergeburt gäbe, würde ich gerne als Präsident oder Papst oder als Baseballspieler mit einer Trefferquote von 400 zurückkommen. Aber jetzt würde ich gerne als Anleihemarkt zurückkommen. Damit kann man alle einschüchtern.“ Damals lag die amerikanische Staatsschuldenquote (Schulden der Bundesregierung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) bei rund 40 Prozent. Steigende Staatsanleihe-Renditen Ein Vierteljahrhundert später drängt Präsident Donald Trump seine Parteifreunde, ein Steuer- und Ausgabengesetz auf den Weg zu bringen, das den fehlgeleiteten finanzpolitischen Kurs der US-Regierungen der vergangenen Jahre fortsetzt. Aktuell produziert die Bundesregierung ein Jahresdefizit von rund zwei Billionen Dollar. Mit dem aktuellen Gesetzentwurf würde das Defizit binnen der nächsten zehn Jahre auf bis zu drei Billionen Dollar im Jahr anschwellen, die Staatsschuldenquote erreichte 125 Prozent. Die jährlichen Zinszahlungen übersteigen jetzt schon das Verteidigungsbudget und nähern sich der Schwelle von 15 Prozent des Haushalts. Das war das Niveau, das die Clinton-Regierung einst brutal zum Sparen animierte. Niemand sollte sich daher wundern, dass es seit Wochen am Anleihemarkt brodelt. Am Mittwoch fand eine Auktion für US-Staatsanleihen weniger Nachfrage, als die Profianleger erwartet hatten. Die Folge war, dass die Renditen für Staatsanleihen mit langer Laufzeit deutlich nach oben kletterten. Die Angst schwappte auf die Aktienmärkte über und schickte die führenden Indizes in den Keller. Anleger fürchten zu Recht um die Konjunktur. Denn die Regierung droht mit ihrer Kreditaufnahme die Zinsen nach oben zu drücken und damit private Investitionen zu drosseln. Die Arithmetik ist unbestechlich Nach Schätzungen der Rechnungsprüfer des Kongresses (CBO) lässt jeder Dollar, um den das Bundesdefizit steigt, die privaten Investitionen um 33 Cent sinken. Dass Präsident Trump alles daransetzt, die von ihm in seiner ersten Regierung auf den Weg gebrachte Steuerreform zu erhalten, ist naheliegend. Der „Tax Cuts and Jobs Act“ von 2017 stimulierte nach den wirtschaftlich lahmen Obama-Jahren die Konjunktur. Doch diesmal dürfte die Wirkung verpuffen, weil nahezu Vollbeschäftigung herrscht und Trumps Zollpolitik die Investitionen dramatisch verteuert. Das große Versprechen, für sich selbst aufzukommen, erfüllte die Reform ohnehin nie. Das war gelogen. Mit der Lüge ließ sich leben, solange die Realzinsen für US-Staatsanleihen niedrig blieben trotz schnell wachsender Staatsschulden. Das hat sich geändert. Trump sattelte noch weitere Steuerversprechen drauf und weigert sich gleichzeitig, die großen Ausgabenposten für Verteidigung, Rente und Krankenversicherung für Ältere anzutasten und Leistungen zu kürzen. Das mag populär sein, verantwortungsbewusst ist es nicht. Die Arithmetik ist unbestechlich. Die amerikanische Regierung gibt zu viel Geld aus und nimmt zu wenig Geld ein. Die Lage verschlimmert sich jedes Jahr, weil ein wachsender Anteil der Einnahmen für Zinsen verwendet werden muss. Deshalb wäre heute ein guter Zeitpunkt, das Ruder herumzureißen. Gestern wäre es sogar noch besser gewesen, ganz zu schweigen von den Tagen davor. Zu den betrüblichen Wahrheiten gehört aber auch, dass selten ein Kongress so weit entfernt von einer verantwortungsbewussten Fiskalpolitik agierte wie der aktuelle. Zunehmend unterwürfige Republikaner scheuen sich, ihrem Präsidenten einen Wunsch abzuschlagen. Von den Demokraten darf man allerdings auch nicht zu viel erwarten. Sie werfen Trump aktuell vor allem vor, er spare zu viel und mache seinen reichen Freunden Steuergeschenke. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Dem Zwang zur Reform der großen Ausgabenprogramme für Soziales, Gesundheit und Verteidigung können auch sie sich nicht auf Dauer versperren. Die Kapitalmärkte sind die verbliebene Instanz, die für die Steuerzahler von morgen kämpft und den zunehmend dysfunktionalen Demokratien Realitätssinn aufzwingen kann. Dass man sich besser nicht mit ihnen anlegt, haben schon viele Regierungen schmerzhaft erfahren.
USA: Ausgaben zu hoch, Einnahmen zu gering – Problem seit Langem