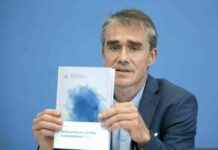TV-Kritik zur Schlussrunde: Positives Fazit der Sendung!
27 Prozent der Wähler haben sich noch nicht entschieden, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben werden. Ob sie es nach diesem politischen Fernsehabend besser wissen? In jedem Fall war die sogenannte Schlussrunde von ARD und ZDF nicht nur lebhaft, sondern auch interessant. Es ging um drei Themen: Wie den Frieden in Europa sichern? Was am Gesundheitssystem ändern? Und: Wie mit den Interessen der jüngeren Wähler umgehen? Wobei sich insbesondere die letzte Runde dann doch recht weit von ihrem eigentlichen Sujet entfernte und sich in Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und eine sozialgerechtere Klimapolitik verlor.
Eine beachtliche Leistung
Um das einmal aller Manöverkritik und Notenvergabe vorauszuschicken: Es war eine beachtliche Leistung sowohl der beiden Moderatoren Diana Zimmermann und Markus Preiß als auch der acht anwesenden Spitzenpolitiker, sich innerhalb von 90 Minuten sehr unterschiedlichen Themen zu widmen, dabei die Redebeiträge recht ausgewogen zu verteilen und sich gegenseitig im Großen und Ganzen recht anständig zu behandeln. Ja, insbesondere Annalena Baerbock von den Grünen wurde von den Männern an ihrer rechten Seite immer wieder unterbrochen und polemisch traktiert, was sie am Ende zu einem unbestimmten Sexismus-Vorwurf motivierte und die frauensolidarische Schützenhilfe von Alice Weidel einbrachte, aber auch sie selbst schlug mitunter hart zu und verteilte Spitzen, zum Beispiel gegen CSU-Mann Alexander Dobrindt, der ihrer Ansicht nach „bekanntlich nichts für Frauen“ übrighabe.
Vor allem zum ersten Thema, dem drohenden Diktatfrieden in der Ukraine, prallten die Ansichten aufeinander. Da wurde mit Vorhaltungen und Schicksalsvokabeln um sich geschmissen: Linke, BSW und AfD zeigten sich einig in ihrer Ablehnung von Waffenexporten, Nato-Bündnis und einem Mehr bei den Rüstungsausgaben. SPD, Union, FDP und Grüne hingegen signalisierten ihren Willen, die Politik der Zeitenwende weiterzuführen und die Ausgaben für die Verteidigung sogar noch deutlich zu steigern. Ob dafür die Schuldenbremse gelockert oder gemeinsame europäische Kredite aufgenommen werden müssen, blieb offen. Eindeutig war jedenfalls, dass zu dem nach Umfragen gerade wichtigsten Thema der Deutschen, „Frieden und Sicherheit“, fundamental unterschiedliche Positionen zur Auswahl stehen.
Den Epochenwandel im Mund
Bei der Frage, wie ein etwaiger Frieden in der Ukraine gesichert werden könnte und ob dafür auch deutsche Soldaten an die ukrainisch-russische Grenze – wo immer sie dann verlaufen wird – geschickt werden müssten, wurde es auffallend still im Studio. Nur Außenministerin Baerbock zeigte sich für eine deutsche Beteiligung an einer etwaigen Friedenstruppe offen. Während CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann lieber das etwas floskelhaft gewordene Schicksalswort vom „Epochenwandel“ in den Mund nahm und ansonsten über die neue Führungsrolle in Europa sprach, die Deutschland in Zukunft wieder einnehmen müsse.
Das Duzen als Machtmittel
Christian Lindner, der nach eigenen Angaben fest davon ausgeht, dass seine FDP 5 Prozent erreichen und damit in den Bundestag einziehen wird, gab noch einmal den staatsmännischen, rhetorisch gewieften, leicht überheblichen Erklärer. Die Zeit der „feministischen Außenpolitik“ sei endgültig vorbei, ächzte er in Richtung Baerbock, die ihn mit einem „Hören Sie mal“ anfuhr, das er so nicht stehen lassen wollte: „Bisher haben wir uns immer geduzt.“ Überhaupt schien es ihm wichtig zu zeigen, wie eng er mit den Anderen in der Runde bekannt sei, wie gut er zum Beispiel „Carsten“ kenne. Das Duzen hat in diesem Zusammenhang eben auch eine machtpolitische Komponente, weil es den unentschlossenen Wählern suggeriert: „Wenn ihr mich wählt, werde ich schon in die Regierung kommen. Und sei es nur, weil ich die entscheidenden Handynummern im Adressbuch habe.“
Ganz normal sprechen, bitte!
Um noch kurz bei der rhetorischen Analyse zu bleiben: Interessant, wie souverän Alice Weidel inzwischen im Öffentlich-Rechtlichen agiert und sich fast ohne Aussetzer einordnet in das Glied der Altparteien. Nur manchmal verliert sie kurz die Nerven und herrscht einen im halben Predigerton sprechenden Carsten Linnemann nicht ganz zu Unrecht an: „Sie können auch ganz normal mit mir sprechen.“ Ein wegen der Themen spannender Abend. So sachlich, wie das im Format der Talkshow eben möglich ist. Mitunter ging es so leidenschaftlich hin und her, dass die Kamera nicht ganz hinterherkam, dafür kehrte immer wieder Ruhe ein, wenn zu Beginn einer neuen Runde eine provokative Frage gestellt wurde, auf die alle mit einem Ja- oder Nein-Kärtchen antworten mussten.
Gesellschaft toxisch anzünden
Insbesondere ARD-Moderator Preiß wirkte ruhig, konzise und sehr gut informiert. Darüber hinaus sah man ihn hin und wieder auch einmal herzlich lachen. Ebenfalls eine gute Figur machte SPD-Generalsekretär Miersch, der nicht nur inhaltlich ein paar klare Punkte setzte, sondern auch von seinem zurückhaltenden Auftreten her sehr sympathisch, fast schon vornehm wirkte. Geduldig ließ er sich kritisieren, schaute den Gesprächspartnern in die Augen und verzog, auch wenn er nur zuhörte, keine Miene. Nur einmal, als es um Bildungsgerechtigkeit ging, verlor auch Miersch die Nerven und warf Carsten Linnemann vor, die Gesellschaft „toxisch anzünden“ zu wollen.
Die zweite Diskussionsrunde rund um das Gesundheitssystem geriet zur besten, weil überparteilichsten Passage des Abends. Die Überlastung der Medizin durch Bürokratie, der Fachkräftemangel und die gestiegenen Kosten waren das konsensuelle Thema, aber natürlich konnte es die AfD-Chefin Weidel nicht ganz lassen, auch hier ihr Lieblingsthema zumindest einmal unterzubringen: der millionenfache illegale Zuzug in unsere Sozialsysteme. Solidarische Bürgerversicherung Der Punkt lässt sich in der Tat nicht ganz zurückweisen, deshalb verlagerte sich die Diskussion unter Anleitung der FDP bald zu einem Gespräch über das Für und Wider einer privaten Krankenversicherung beziehungsweise einer selbstverwalteten Rente. Während die einen mehr Eigenverantwortung in Aussicht stellen, schon allein um die explodierenden Kosten für die Pflege in den nächsten Jahren zu kompensieren, versprechen die anderen (SPD und Linke) eine „solidarische Bürgerversicherung“ mit Termingarantie. Sahra Wagenknecht hingegen sieht das Urübel darin, dass Krankenhäuser inzwischen total kommerzialisiert sind. Dass Ärztehäuser von Finanzinvestoren übernommen werden, darin ist sie sich mit ihrem ehemaligen Linken-Kollegen Jan van Aken einig, ist ein Skandal: „Gesundheit darf man nicht dem Markt überlassen“, ruft Wagenknecht – über den Satz gibt es keinen Dissens.
Beißlust ist geschwunden
Im Angesicht von 5,7 Millionen Menschen, die in diesem Land gerade pflegebedürftig sind und den stetig wachsenden Zahlen in diesem Bereich, sucht die Spitzenpolitik untereinander den Schulterschluss. Selbst ein Vorschlag der AfD zur Bezahlung von Pflegeleistungen innerhalb der Familie wird als „sympathisch“ bezeichnet. Überhaupt fällt auf, dass die Vertreter der anderen Parteien die Beißlust in Sachen AfD etwas vergangen ist. Davon profitiert unter anderem die Linke, die zuletzt wieder mehr Aufmerksamkeit bekam und mit ihrer salonfähigen, weil antikapitalistischen Variante des Populismus gerade ein paar überraschende Punkte macht. Dabei ist ihr entscheidendes politisches Angebot ziemlich platt: die Reichen ärmer machen. Das Vermögen der knapp 130 Milliardäre im Land könnte, so die Rechnung der Linken, bei stärkerer Besteuerung beispielsweise für Bildung und Pflege aufkommen. Das klingt anziehend, hätte in der Realität allerdings weit weniger Effekte als man sich vorstellen mag. Nicht nur, weil bei so einem Politikwechsel wohl viele Superreiche schnell das Land verlassen würden.
„Einfach mal machen“
Den besten Satz für die Kollegen der „heute“-Show lieferte übrigens an diesem Abend Carsten Linnemann, als er, von den Moderatoren unterbrochen, gerade noch einen Gedanken zu Ende führen wollte: „Deshalb sage ich: Einfach mal machen, das müssen wir machen!“ So ein Satz bleibt hängen. Der verfängt und bindet…Eine Überraschung hatte Alice Weidel an diesem Talkabend dann doch noch zu bieten: Und zwar beleidigte sie die deutsche Heeresführung. Da gäbe es gerade nämlich keine Entscheidungsträger, die „Ahnung vom Sujet Krieg“ hätten. „Zum Glück“ will man da nur sagen und Frau Weidel wünschen, dass sie die von ihr vorgeschlagenen zwei Jahre Wehrdienst selbst irgendwo in den schönen Schweizer Bergen ableisten kann.
Knappe drei Tage vor der Wahl präsentieren sich die deutschen Spitzenpolitiker an diesem Abend erstaunlich souverän und aufgeschlossen. Man darf ja nie vergessen, dass es sich bei Politikern am Ende ja um jene Menschen handelt, die sich an kalten Wochenenden an den Straßenständen teils wüst beschimpfen lassen müssen. Um jene, die immer für die Krise, aber selten für Erfolge verantwortlich gemacht werden. Um jene, die ihr eigenes Privatleben dem (immerhin ziemlich gut bezahlten!) Dienst an der Gemeinschaft unterordnen. Um jene Menschen also, die ihr Gesicht hinhalten, wenn sie sich uns zur Wahl stellen. Und dann auch jene Demütigung in Kauf nehmen, die es bedeuten muss, abgewählt zu werden. Jene Menschen jedenfalls sieht man an diesem Abend hinter den parteipolitischen Vorhängen ihrer medialen Existenz hervorgucken. Ohne, dass es je um das Privatleben der einzelnen Kandidaten gegangen wäre, hatte man so das Gefühl einer gewissen Nähe und Unmittelbarkeit. Und das ist, ein paar Tage vor der Wahl, nicht der schlechteste Eindruck, den man vom politischen Spitzenpersonal bekommen kann.