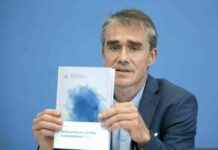Der Fokus auf den Gazakrieg: Solidarität bedeutet, sich den eigenen Abgründen zu stellen
Der Nahost-Konflikt wird von unserer Kolumnistin als zu einseitig dargestellt kritisiert. Er wird oft als Bühne für moralische Selbstinszenierung genutzt.
Die Grenze zwischen Israel und Gaza, am 19.5.2025
Foto:
Ohad Zwigenberg/ap
Ein Spruch, ein allgemeiner Wunsch lautet: Das Leiden muss enden. Für alle Konflikte dieser Welt. Für die Ukraine, für Syrien, Kaschmir, den Sudan – für die Menschen in Gaza. Für die verschleppten Geiseln. Für Israel.
Und doch drehen sich Kommentare und Appelle übermäßig um Gaza. Kein neues Phänomen. Wer die deutschen Debattenbeiträge der letzten Wochen liest, den Tonfall, die Pathosformeln, die moralische Selbstgewissheit, spürt: Hier wird mehr verhandelt als ein Krieg. Es ist auch Entlastung. Es ist das gute Gefühl, endlich auf der richtigen Seite zu stehen.
Die Lage in Gaza ist desaströs. Hunderttausende hungern, fliehen, trauern. Die Zerstörung, die Unmöglichkeit eines normalen Lebens – katastrophal. Da gibt es kein Aber. Die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu trägt Verantwortung. Sie sollte keine Zeit verlieren, dem ein Ende zu bereiten. Die Hamas darf hier aber nicht vergessen werden. Um den Krieg zu beenden, könnte sie jederzeit kapitulieren, endlich die Geiseln freilassen, ihre Bevölkerung erlösen. Stattdessen führt sie ihren blutigen Terror weiter. Mit realen Menschenleben als Spielball.
Währenddessen klopfen sich Kommentatoren und Social-Media-Aktivisten auf die Schulter. Der Konflikt wird eindimensional dargestellt – als Bühne für moralische Selbsterhöhung. Umso wichtiger, einen Schritt zurückzutreten: Warum gerade hier so leidenschaftlich?
Abwehr von Schuld
Es ist möglich, mehrere Dinge zugleich zu besprechen: Kriegsführung, Forderungen, Kritik – und das Bedürfnis dahinter. Wer mit moralischem Anspruch spricht, muss auch den Ort reflektieren, von dem aus gesprochen wird.
In einer Zeit, in der um Antisemitismusdefinitionen gestritten wird, ist die Frage „Wozu Antisemitismus?“ produktiver. Die Psychoanalytikerin Ilka Quindeau beschreibt Antisemitismus als unbewusstes Entledigungsmanöver: Er dient der Abwehr von Schuld. Auch das Schuldbekenntnis kann instrumentalisiert werden, zur moralischen Selbstinszenierung.
Diese Dynamik ist präsent, wird aber verdrängt. Sie heißt dann „Israelkritik“, „Humanismus“, „Moral“. Der Vorwurf, Solidarität sei bloß ein Schuldreflex, wie Josep Borrell, Ex-Außenbeauftragter der EU, formulierte, verschiebt die Perspektive. Es entsteht der Eindruck, der Holocaust habe seine Schuldigkeit getan. Dass Erinnerung heute verdächtig sei. Ein gefährlicher Gedanke. Es ist eine dialektische Umkehrung: Nachfahren der Täter fühlen sich ermächtigt, dem jüdischen Staat Lektionen zu erteilen. Die Lehre aus Auschwitz lautet plötzlich: Gerade deshalb müssen wir Israel kritisieren. Ein moralisch bequemes, politisch folgenreiches Paradoxon.
Dazu passt der Umgang mit Margot Friedländers Tod. Sie wird zu Recht geehrt, ihre humanistischen Forderungen, die sie aus ihrer Erfahrung als NS-Überlebende ableitete, leider aber von manchen umgedeutet – als parteinehmender Kommentar zum Krieg in Gaza. Dabei war sie eine versöhnliche Jüdin, sprach über Empathie, Bildung, Menschlichkeit. Sie war anschlussfähig – für ein Land, das sich nach Erlösung sehnt. Ihr „Nie wieder“ war ein Angebot. Bei anderen ist es oft ein Selbstlob.
Wie man Antisemitismus produktiv kritisiert
Was Friedländer nie laut sagte, aber vielleicht dachte: Wahre Solidarität mit Juden heißt, sich den eigenen Abgründen zu stellen – auch den unbewussten. Quindeau schreibt, nur durch Selbstreflexion lässt sich Antisemitismus produktiv kritisieren. Nicht durch Posts. Nicht durch Essays. Und nicht durch einen belehrenden Gestus gegenüber einem Land, das um sein Überleben kämpft.
Vielleicht ist es an der Zeit, Kritik an Israel nicht nur auf moralische Richtigkeit zu prüfen, sondern auch auf ihre Motivation. Wer meint, aus der Geschichte gelernt zu haben, sollte nicht zuerst Israel befragen – sondern sich selbst.