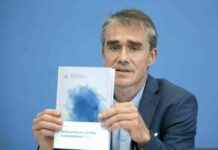Was macht Meta mit den Daten?
Meta hat im April angekündigt, vom 27. Mai an wie in den USA auch in Europa sämtliche öffentlichen Beiträge, Kommentare und Fotos der Nutzer von Instagram, Facebook und Threads sowie Interaktionen mit Metas auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbot zum Training seiner KI zu verwenden. Große KI-Sprachmodelle, auf denen Anwendungen wie ChatGPT oder auch Metas KI-Assistent basieren, werden mit Unmengen an Textdaten aus unterschiedlichsten Quellen trainiert, darunter Bücher, Websites, Artikel – oder soziale Medien. Amerikanische Anbieter verraten meist aber nicht, mit welchen Daten die KI-Modelle trainiert werden. Ausgenommen sind Meta zufolge private Nachrichten und Beiträge von Konten, deren Inhaber nicht volljährig sind. Auch Whatsapp-Nachrichten sind nicht betroffen, weil sie grundsätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Wer seine Daten nicht für das KI-Training hergeben möchte, muss aktiv widersprechen.
Warum denkt Meta, dass das okay ist?
Der Konzern argumentiert, dass das Training mit Beiträgen auf sozialen Medien in der Branche üblich sei. Es gebe ein gesellschaftliches Interesse, dass dabei auch deutschsprachige Beiträge verwendet würden. Nur so verstünden die KI-Produkte die deutsche Kultur und Sprache und die deutschen Werte. Tatsächlich mahnen KI-Fachleute seit Jahren, dass die bekanntesten großen KI-Modelle vor allem mit amerikanischen Daten trainiert würden und dementsprechend geprägt seien. Allerdings sind diese Mahnungen meist mit der Forderung verknüpft, dass es eigene europäische KI-Modelle brauche – und nicht amerikanische KI-Modelle mit europäischem Anstrich.
Darf Meta das eigentlich?
Das ist Auslegungssache – und ein großer Streitpunkt zwischen Meta, Verbraucherschützern und Datenschutzaktivisten. Meta beruft sich nach Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf das „berechtigte Interesse“. Die europäischen Datenschutzbehörden haben sich im vergangenen Dezember auf – eher weitgefasste – Leitlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch KI-Modelle geeinigt. Demnach können sich Digitalkonzerne prinzipiell auf dieses „berechtigte Interesse“ berufen, müssen dafür aber drei Bedingungen erfüllen: Der Anspruch auf Datenverarbeitung muss legitim und wirklich notwendig sein; letzten Endes müssen die Grundrechte der Betroffenen mit dem Interesse des Unternehmens abgewogen werden. Verbraucherschützer betonen, die Leitlinien seien nur eine Behördenmeinung und „kein Blankoschein für ein KI-Training auf Grundlage des berechtigten Interesses“.
Was gibt’s für Kritik an dem Ganzen?
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat vor dem Oberlandesgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen Meta beantragt. Sie kritisiert unter anderem die kurze Frist und den Umstand, dass nur eingeloggte Nutzer der Regelung widersprechen könnten, nicht aber solche, deren Profil womöglich gehackt oder gesperrt worden ist. Auch die von Datenschutzaktivist Max Schrems geleitete Organisation NOYB hat eine Abmahnung an Meta verschickt und droht mit einer europäischen Verbandsklage. Schrems kritisiert, dass Nutzer der Regelung aktiv widersprechen müssen anstatt von Meta um Einwilligung gebeten zu werden.